Ach, es ist doch schön! Die Bevölkerung lässt sich einfach nach Kaufkraftklassen einteilen: 1 ist sehr reich, 4 ist sehr arm und dazwischen gibt’s noch die Klassen 2 und 3 die ein bisschen weniger reich sind, oder ein bisschen weniger arm. Je nachdem. Bloß ist es leider nicht ganz so einfach. Nicht mehr, genauer gesagt, vor ungefähr 30 Jahren war alles noch viel einfacher: Damals konnte man noch vom Äußeren aufs Innere schließen oder vom Verhalten aufs Einkommen. Und genau so sind nämlich die Kaufkraftklassen entstanden.
Warum Kaufkraftklassen und nicht Einkommensklassen?
Tja, warum wohl? Weil das Einkommen zumindest in unseren Breitengraden ein Tabu ist. Die Frage danach führt automatisch zu systematischen Fehlern. Das war den Marktforschern wohl bewusst und deshalb haben eine Methode gewählt, die quasi von hinten durch den Rücken ins Auge zielt: Die Kaufkraftklassen. Im Klartext: Man hat versucht (und tut das noch immer), aufgrund äußerer Merkmale (darunter gehören auch Verhaltensmerkmale und die Geld-Ausgabe-Verhalten) auf das Einkommen und damit auf die soziale Schicht zu schließen. Das ging auch lange Zeit gut, ist heute aber nicht mehr so wahnsinnig Ziel führend, weil sich der „Hybride Konsument“ durchgesetzt hat. Frechheit!
Ausgabe gleich Einkommen
Um Kaufkraftklassen zu definieren geht man also her – besser: ging man her – und schaute sich an, wer sich wie verhält und wer wofür wann wieviel Geld ausgibt. Aus diesen Daten hat man dann Rückschlüsse geschlossen, was sich jemand leisten kann. Wieviel Kaufkraft jemand hat. Dann hat man 4 unterschiedliche Klassen definiert und konnte nun fast alle Menschen einer dieser Klassen zuordnen. Dabei blieben natürlich oben und unten ein paar Promille oder Prozente unberücksichtigt, denn wer sich eine Luxusjacht kaufen kann, der gehört natürlich zu obersten Kaufkraftklasse, eine Jacht zu kaufen ist aber lange kein Kriterium, um in eben diese Klassen-Schublade gesteckt zu werden.
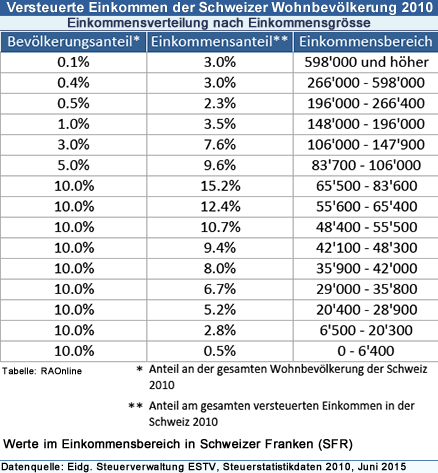
Quelle: Eidgenössische Steuerverwaltung ESTV, Steuersatatistikdaten 2003 und 2010, Juni 2015
Die eidgenössische Steuerverwaltung weiß über Einkommen Bescheid, jedenfalls genauer als die meisten anderen. Folgendes Bild ergibt sich für 2010.
Es würde jetzt natürlich überhaupt keinen Sinn ergeben, die obersten 2 oder von mir aus auch 3 Bereiche als Kaufkraftklasse 1 zu bezeichnen, nur weil sie zuoberst stehen. Das wären viel zu wenige Menschen, um von einer eigentlichen Klasse sprechen zu können. Das sind die, die sich „alles leisten können“ und darum ist die Definition „Kaufkraftklasse 1 sind die Superreichen, die mehrere Häuser haben und First Class fliegen“ vollkommener Quatsch. Die mögen zwar theoretisch zu dieser Kaufkraftklasse gehören, streng genommen tun sie es aber nicht, sie laufen quasi außerhalb des Wettbewerbes.
Die Kaufkraftklassen definieren sich – zum Beispiel bei DemoSCOPE, und die müssen es wissen – über die Begriffe „Oberklasse“, „obere Mittelklasse“, „untere Mittelklasse“ und „Unterklasse“ – was auch nicht besonders charmant klingt. DemoSCOPE ist auch nicht so glücklich damit, denn „Die Zuordnung ist zunehmend problematisch, weil die finanziellen Verhältnisse durch das äussere Auftreten immer schlechter repräsentiert werden. Vor allem die Oberschicht, die obere und die untere Mittelschicht (Anm. des Autors: also fast alle) lassen sich nicht mehr sauber auseinanderhalten.“
Quelle: http://www.demoscope.ch/auftraggeber/lexikon/lexikon-detail/kaufkraftklassen-kkk/
Heißt: Eigentlich sind KKK’s Quatsch. Früher konnte man sie noch auseinanderhalten: Der Bankdirektor hatte ein Haus, fuhr Mercedes, trug Maßanzüge und trank teuren Wein. Die Frau hatte in Pferd. Heute ist das alles nicht mehr so: junge, reiche Start-upper tragen löchrige Jeans und haben Kohle ohne Ende. Wie soll man da noch vom Äußeren aufs Geld schließen. Trotzdem sind die Kaufkraftklassen noch nicht ganz tot, wenn sie auch zunehmend durch die – sinnvolleren – Sinus-Milieus ersetzt werden.
Versuch einer Eingrenzung
- Kaufkraftklasse 1 / Oberklasse
Die Menschen, die hier dazu gehören, müssen sich im Alltag keine Gedanken über alltägliche aber auch luxuriöse Anschaffungen machen. Das Auto kann gerne neu sein und teuer (nicht Rolls Royce, aber ein neuer Audi A6 ist schon ok), Urlaub wird gebucht und zwar nach Vorlieben und nicht nach Schnäppchen, auswärts essen liegt gerne öfter mal drin und Kleider kauft man sich, wenn man will und wenn man was Schönes sieht. Und immer noch bleibt Geld übrig um zu sparen. Eigentumswohnung oder Haus sind in dieser Klasse weit vertreten, falls nicht darf‘s auch eine teure Maisonette-Wohnung sein. Und auch ein paar Statussymbole wie eine schöne Uhr, eine tolle Stereoanlage oder sonst was in der Richtung. Zu dieser Gruppe gehören etwa 10% der Schweizer Bevölkerung (das sind NICHT die „obersten 10.000“ – das wären dann die stinkreichen). - Kaufkraftklasse 2 / obere Mittelklasse
Denen geht es nicht schlecht, nur um sich ein neues Auto zu kaufen, müssen sie schon länger sparen – es ist dann halt ein A4. Ein Häuschen kann drin liegen, aber dann eher in Gebieten, die ein bisschen billiger sind (dafür sind dann die Steuern höher, Ätsch!), auch Ferien sind drin, nicht grade immer nach Mauritius, aber mal nach Italien, mal nach Frankreich – kann auch Hurgadha sein oder die Kanaren. Die Uhr ist etwas billiger (Tissot statt Omega oder Rolex), der Fernseher tipp top aber halt nicht der Allerneueste und bei den Kleidern und Schuhen kauft man sich Markenware, aber halt mit ein bisschen Augenmaß. Auswärts Essen ist zwar nicht alltäglich, liegt aber schon drin und auch die eine oder andere Ausgabe, die nicht geplant war. Die Gruppe wird nicht nervös, wenn der Staubsauger kaputt geht. Dazu gehören etwa 35% der Bevölkerung. - Kaufkraftklasse 3 / untere Mittelklasse
Die müssen schon länger sparen um sich weniger leisten zu können. Ein Auto haben sie meist auch, aber einen gebrauchten Japaner. Auswärts essen ist sehr selten, zum Muttertag aber schon, Brunch im Landgasthof. Ferien gibt’s natürlich immer noch, aber oft zuhause oder mit Easy Jet für 399 für zwei Wochen nach Antalya. Die Kleider kauft man sich gerne beim Sonderverkauf, und auch sonst achtet man schon aufs Geld. Man muss sich für größere Anschaffungen schon nach der Decke strecken und die Krankenkassenprämien reißen ein großes Loch ins Monatsbudget. Ende des Monats wird’s sowieso mal eher eng. Groß sparen liegt da nicht drin, aber ein bisschen schon. Rund 40% der Schweizer geht es etwa so. - Kaufkraftklasse 4 / Unterklasse
Darunter fallen NICHT die ganz Armen – genauso wenig wie die Superreichen eigentlich zu KKK 1 gehören. Zu diesen rund 15% gehören die, die sich im Alltag schon schwer tun mit Anschaffungen: Kleider werden gerne mal von den Geschwistern übernommen, ein neuer Fernseher liegt einfach nicht drin (obwohl er „nur 299 Franken“ kostet), in der Küche plärrt ein altes Radio und die Matratzen sind auch schon älter. Ferien? Die Kinder können ins Lager, oder man fährt zu Bekannten, oder geht halt gar nicht. Ein Zoo-Besuch liegt wenn überhaupt nur ganz selten drin.
Abgrenzung mit dem Median
Der Median des monatlichen Bruttolohnes in der Schweiz betrug 2010 rund 6.000 Franken. Die Abgrenzung kann man nun auch anhand dieses Medians vornehmen (wird zum Beispiel in Deutschland so gehandhabt)
- Einkommensreiche Schicht: Mehr als 250% des Medians (also mehr als 15.000 Franken/Monat)
- Einkommensstarke Mitte: 150 – 250% des Medians (9.000 – 15.000 Franken/Monat)
- Mitte: 80 bis 150% des Medians (4.800 – 9.000 Franken/Monat)
- Einkommensschwache Mitte: 60 – 80% des Medians (3.600 – 4.800 Franken/Monat)
- Einkommensarme Schicht: unter 60% des Medians (unter 3.600 Franken/Monat)
Die Abgrenzungen zwischen den Klassen (egal ob KKK oder nach Median) ist deshalb so schwierig, weil sich das Konsumverhalten geändert hat: Jemand aus einer tieferen kann durchaus ein teures Auto haben, das der höheren Klasse zugeordnet werden würde – er muss dafür aber auf Anderes verzichten. Wenn man jetzt nur das Auto anschaut, dann könnte man ihn glatt in einer höheren oder hohen Klasse einordnen. Was falsch wäre, weil eben andere Produkte, die diese Gruppe regelmäßig kauft oder konsumiert für ihn aufgrund seines „Hobbys“ außerhalb seiner finanziellen Reichweite liegen. Außerdem kommt es natürlich darauf an, ob man alleine lebt, als Paar ohne Kinder, oder als Familie mit einem, zwei oder mehr Kindern… je mehr Kinder, desto weniger kann man sich natürlich mit dem gleichen Einkommen leisten. Als Ersatz hat man aber ja die Kinder…
Um dieses Dilemma ein bisschen zu mildern, sind die Sinus-Milieus ein ganz taugliches Mittel, weil sie eben die Bedürfnisse deutlich mehr gewichten als das reine Einkommen und damit dem eigentlichen Verhalten der unterschiedlichen Gruppen deutlich näher kommen.

